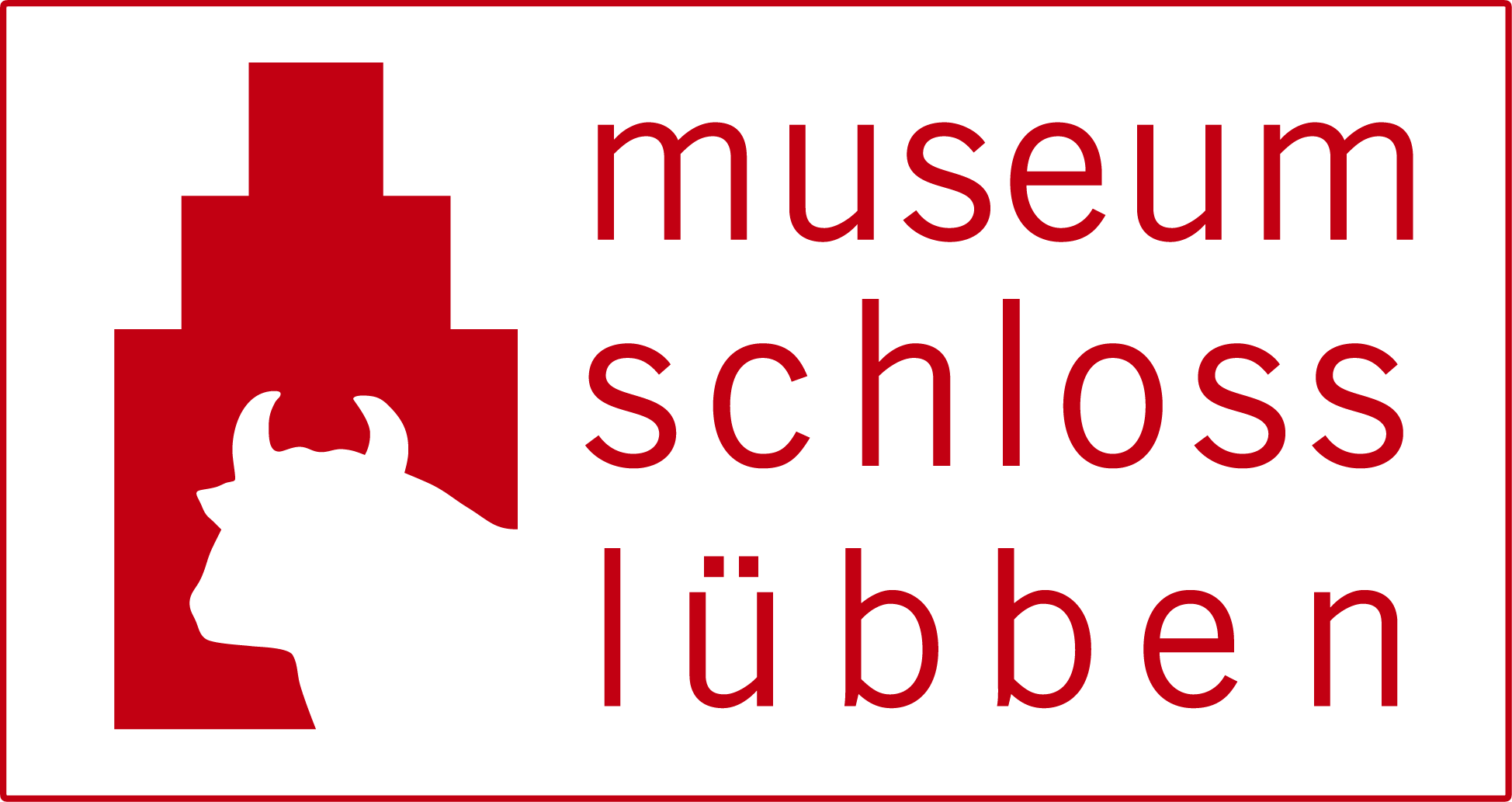Aus dem Jahr 1790 ist ein Versuch bekannt, die Schulpflicht in Lübben einzuführen. Kinder ab dem 7. Lebensjahr sollen in den Wintermonaten jeden Tag in die Schule gehen, im Sommer an drei Tagen je Woche. Im Winter ruht die Landwirtschaft, doch im Sommer ist die Arbeitskraft unentbehrlich. Die Umsetzung scheitert, denn für die 80 Gemeinden gibt es nur 13 Schulmeister.
In den Folgejahren steigt die Zahl der Lehrer stetig, doch Mittel für die Reform des Elementarschulwesens fehlen. Die Neuregelung ist notwendig, da es nach wie vor viele Analphabeten in Lübben gibt. Weder der sächsischen noch der brandenburgischen Regierung ab 1815 gelingt es, die Schulpflicht flächendeckend durchzusetzen.
Ab dem Jahr 1830 gibt es drei Schulen in Lübben. Die Elementarschule besuchen Mädchen und Jungen. Im Anschluss folgt die Trennung nach Geschlechtern. Mädchen dürfen für drei weitere Jahre an die höhere Töchterschule wechseln, Jungen können für fünf Schuljahre an die höhere Bürgerschule versetzt werden. Diese Schulen sind schulgeldpflichtig. Nicht alle Familien können das Geld aufbringen.
In Steinkirchen – heute ein Ortsteil von Lübben – unterrichten auch Handwerker die Kinder. Sie lehren den Katechismus, Lieder und Bibelverse sowie Schreiben, Lesen und Rechnen. Aus dem oft religiösen Unterricht ergibt sich eine Trennung in evangelische und katholische Schulen. Sie sind meist klein und privat organisiert, „Winkelschulen“ genannt. Für Kinder, die nachmittags arbeiten, bietet eine „Nebenschule“ vormittags Unterricht an.
Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts gelingt endgültig die Durchsetzung der Schulpflicht, 1919 wird sie in die Weimarer Verfassung aufgenommen.
In Lübben gibt es heute drei Grundschulen, eine Oberschule, ein Gymnasium und ein Oberstufenzentrum sowie zwei Förderschulen. Ein Schulgeld muss nur noch für die Kreismusikschule gezahlt werden.