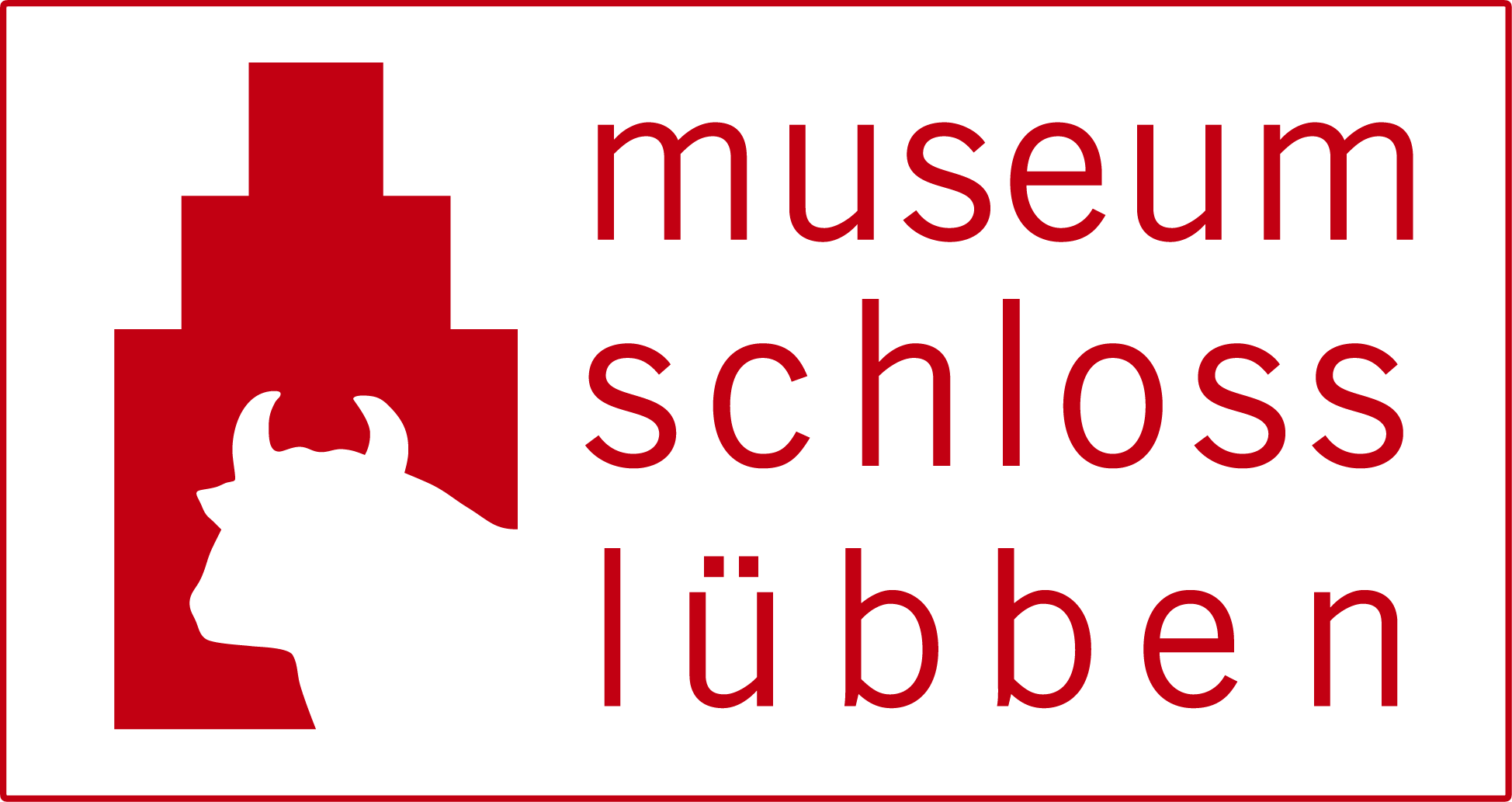Aufwachsen in Lübben bedeutet eine Kindheit an der Spree, zwischen Fließen und Kanälen. Im Sommer wird sie als Freibad genutzt, im Winter zum Schlittschuhlaufen oder Schlitten fahren.
In der Spree waren für Kinder schon im 19. Jahrhundert eigene Badeplätze abgesteckt, sie konnten in der Nähe der Brücke am Berliner Tor ins erfrischende Nass. Ältere Kinder und Schulkinder bekamen einen anderen Platz zugewiesen.
Die Kinder der Stadt bewegten sich lange Zeit zwischen Arbeit und Schule. Sie wurden in jungen Jahren in der Landwirtschaft eingesetzt, häufig auf Kosten des Schulbesuches. In den 1880ern arbeiten auch im Lübbener Trikotagenwerk Kinder. 12- bis 14-jährige arbeiten bis zu sechs Stunden, ältere Jugendliche täglich neun Stunden. Der Lohn war niedrig, doch für viele Familien lebensnotwendig. Erst in den folgenden Jahrzehnten wird die Kindheit als ein Lebensabschnitt angesehen, der besonders geschützt werden muss.
Selbst mit diesem Schutz bedeutet eine Kindheit in Lübben keine sorglosen, langen Sommer, sondern auch Aufwachsen im Nationalsozialismus und im Krieg. Jugendorganisationen formen die Kinder, während ihre Väter an der Front kämpfen und ihre Mütter den Kriegsalltag bewältigen müssen. Lübbener Kinder wachsen auch in den Trümmern der Nachkriegsjahre auf. Sie werden in der DDR streng dazu angehalten das blaue FDJ-Hemd zu tragen. Kinder und Jugendliche aus den „Wende“-Jahren berichten von neuen Freiheiten und Möglichkeiten, die häufig von Sorgen der Eltern begleitet wurden.