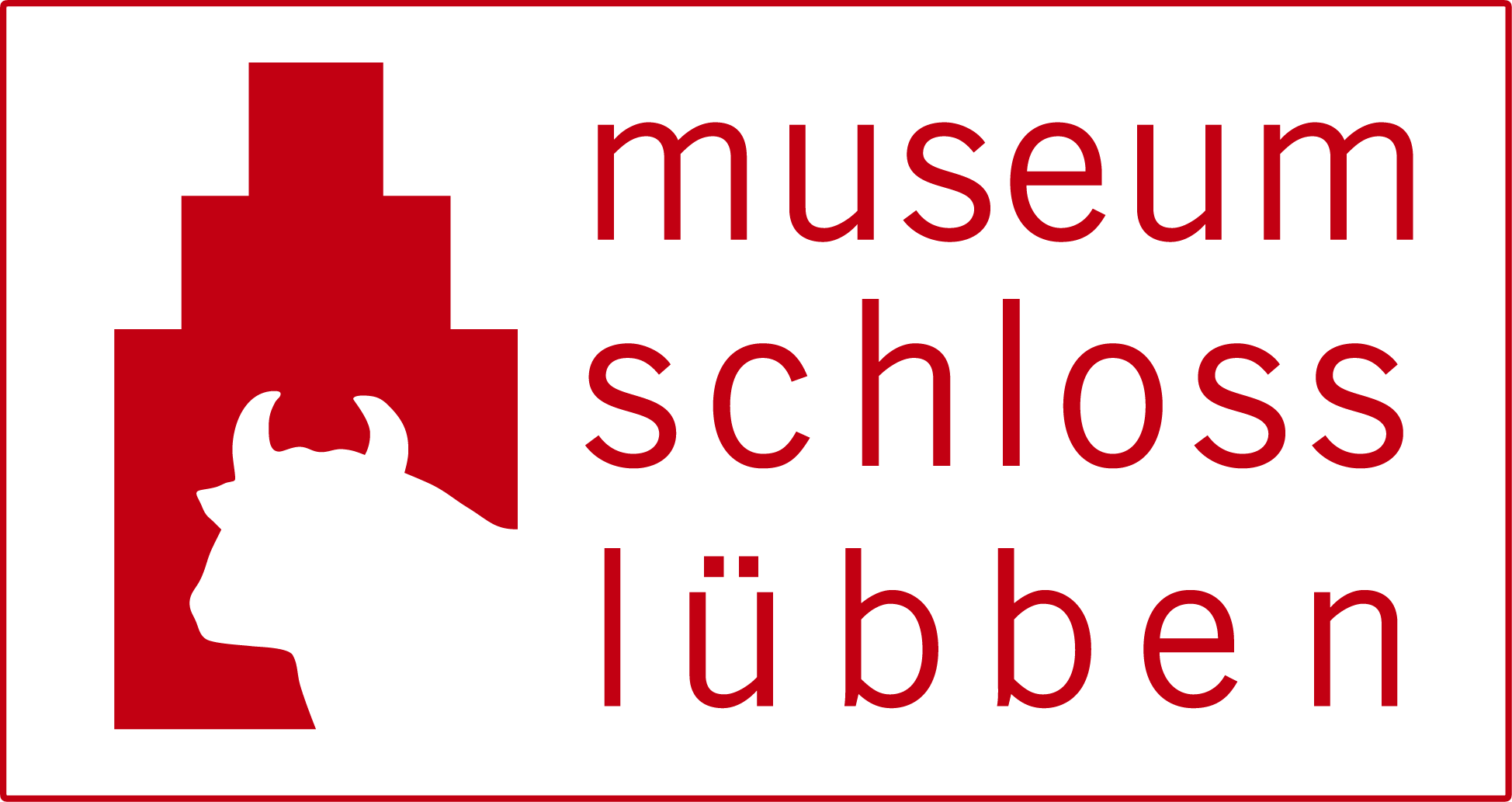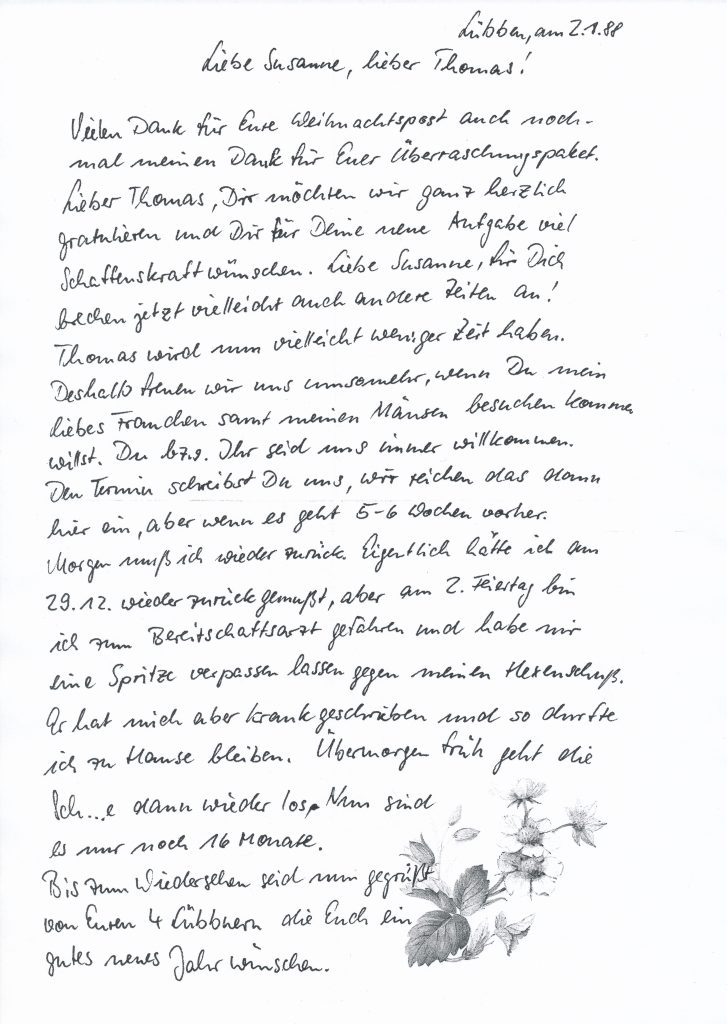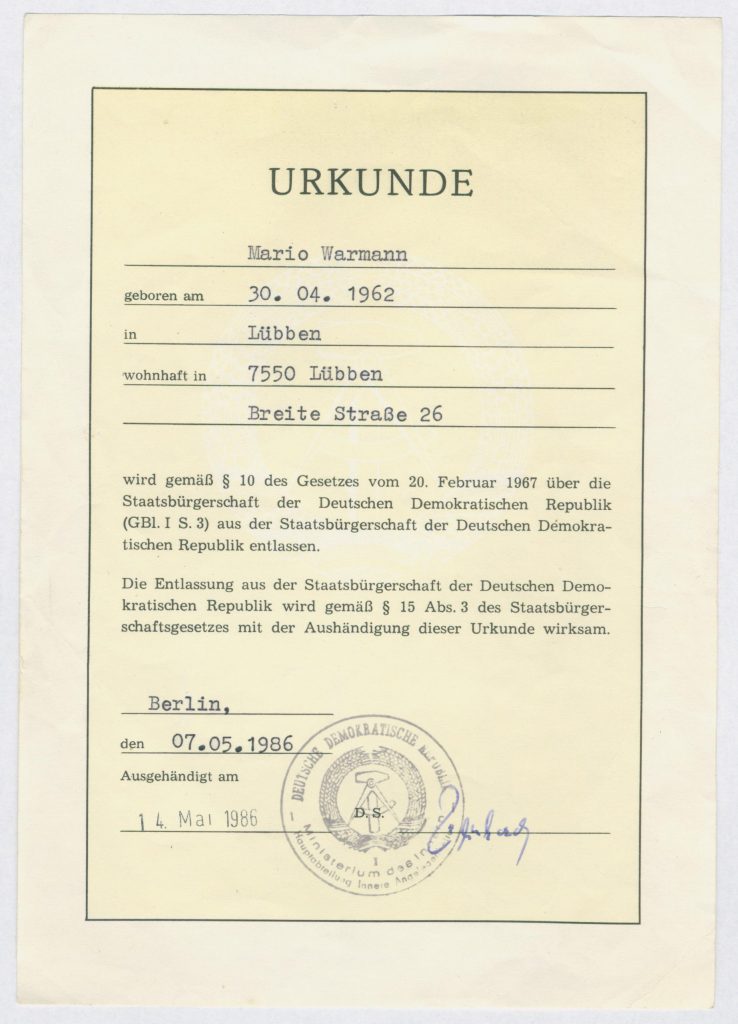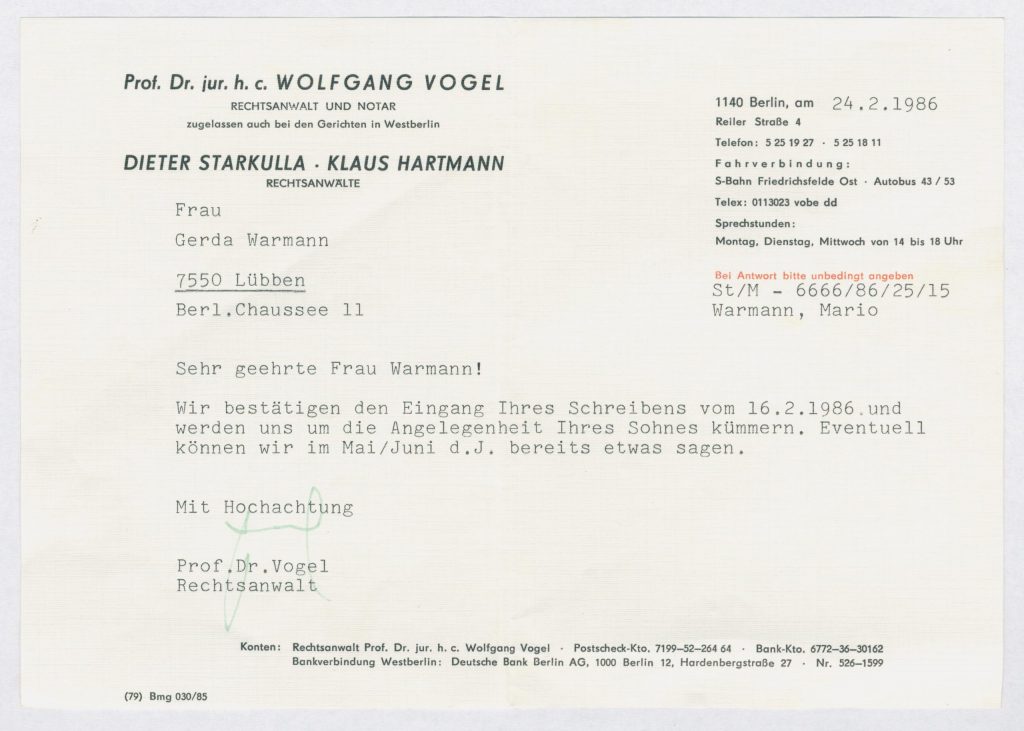Bereits mit dem Ausbruch des 2. Weltkriegs im September 1939 ändert sich das Stadtbild Lübbens. Junge Männer und Familienväter, Arbeiter und Angestellte werden an die Front einberufen. Betriebe und Firmen stellen ihre Produktion auf kriegswichtige Güter um, andere Waren werden knapp. Schon im September fällt der erste Lübbener bei dem deutschen Überfall auf Polen.
Kriegsgefangene aus verschiedenen europäischen Ländern werden in Lübben inhaftiert, Zwangsarbeiterinnen in der hiesigen Industrie eingesetzt.
In der Stadt werden in der Kriegszeit Untertrikotagen (Unterwäsche) für die Wehrmacht hergestellt, in den letzten Wochen sogar „Gasschutzanzüge“ für Kleinkinder.
Mit der Bombardierung Berlins ab 1943 suchen Menschen aus der Hauptstadt Zuflucht im nahegelegenen Spreewald, sie werden jedoch abgewiesen und zurückgeschickt.
Später durchqueren Flüchtlingstrecks aus dem Osten die Stadt. Zeitgleich schreibt die Lübbener Zeitung von einer uneinnehmbaren Festungslinie, gemeint ist die Oder. Lübben selbst wird erst spät, im April 1945, zu einem Kriegsschauplatz als die sowjetische Armee vor der Stadt steht. Die auf Grund der verkehrswichtigen Lage zur Festung erklärte Stadt trifft es umso härter. Zwischen dem 20. und 27. April wird ein Großteil der Altstadt zerstört, denn der Stadtkommandant lehnt eine Kapitulation ab. Brücken sind nicht mehr nutzbar. Die Versorgung mit Elektrizität, Wasser und Gas bricht zusammen. Ein Großteil der Wohngebäude ist beschädigt, etwa jedes vierte Haus völlig unbewohnbar.
Die Wendische Kirche wird zerstört, die bereits baufällige Hospitalkirche am Hain weiter beschädigt, sodass sie in der Folge 1948 abgetragen wird.
Auf deutscher und sowjetischer Seite sterben in dieser letzten Kriegswoche in Lübben über 300 Soldaten. Mehr als 500 Zivilpersonen finden den Tod.